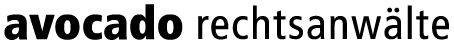Vergabe neu gedacht? Der Kabinettsentwurf für ein Vergabebeschleunigungsgesetz im Überblick
Die öffentliche Auftragsvergabe in Deutschland hat den Ruf, schwerfällig, bürokratisch und oft innovationsfeindlich zu sein. Mit dem am 06.08.2025 vom Kabinett beschlossenen Entwurf eines Vergabebeschleunigungsgesetzes geht der Gesetzgeber gezielt die Kritikpunkte der Praxis an: Vergabeverfahren sollen schneller, unbürokratischer und praxisnäher werden. Aber welche konkreten Änderungen kommen auf Auftraggeber und Unternehmen zu? Und gehen die Vorschläge wirklich weit genug? Im Folgenden finden Sie eine Übersicht zu den wesentlichsten Vorhaben.
Vereinfachung und Flexibilisierung der Strukturen
Im Mittelpunkt des Gesetzesentwurfs steht die Vereinfachung der Strukturen. U. a. ist vorgesehen:
- Ausweitung von Direktvergaben: Durch Änderungen im Bundeshaushaltsrecht soll es Auftraggebern des Bundes dauerhaft ermöglicht werden, Leistungen bis zu einem Auftragswert von 50 000,- € ohne Umsatzsteuer per Direktauftrag zu beschaffen.
- Freie Verfahrenswahl im Unterschwellenbereich: Auftraggebern des Bundes soll außerdem im Unterschwellenbereich die freie Wahl zwischen Öffentlicher Ausschreibung, Beschränkter Ausschreibung und Verhandlungsvergabe bzw. Freihändiger Vergabe (jeweils mit Teilnahmewettbewerb) eingeräumt werden. Entsprechende Folgeänderungen in der UVgO sind bereits angekündigt.
- Planungsaufträge als Baulose: In § 2 VgV soll die Möglichkeit der Vergabe von Planungsleistungen als Los eines Bauauftrags festgeschrieben werden. Der Clou dabei: In solchen Konstellationen wären Planungsleistungen nur dann noch EU-weit ausschreibungspflichtig, wenn der Wert aller Lose den EU-Schwellenwert für Bauleistungen (i.H.v. aktuell 5.538.000,- €) erreicht. Darüber hinaus bestünde die Möglichkeit, auch bei Überschreitung des Schwellenwertes durch den Gesamtauftrag die Planungsleistungen dennoch gemäß § 3 Abs. 9 VgV national zu vergeben, solange ihr Wert für sich gesehen nicht (auch) den EU-Schwellenwert für Bauleistungen überschreitet und maximal 20 % des Gesamtauftragswertes ausmacht. Faktisch wären Planungsleistungen damit erst ab einem Honorar von ca. 1,1 Mio. € netto (20 % von 5.538.000,- €) EU-weit zu vergeben.
- (Kleinere) Einschränkungen des Losgrundsatzes: Ein großes Thema in der Vergabepraxis ist seit Jahren die dem deutschen Vergaberecht eigene, strenge Pflicht zur Losbildung – also zur Zerlegung großer Aufträge in kleinere Einheiten, um insbesondere KMU bessere Chancen zu eröffnen. Der Kabinettsentwurf schränkt dieses Gebot nun gezielt für bestimmte Vorhaben ein, die nationale Sonderinteressen verfolgen, nämlich dringliche Großprojekte, die aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität finanziert werden, sowie (zunächst befristet bis 31.12.2030) sicherheitsrelevante Vergaben. Die erhoffte Dynamisierung des Marktes bleibt also punktuell, kann aber für spezielle Projekte durchaus Relevanz entfalten.
- Klarstellungen für Inhouse-Vergaben und öffentliche Kooperationen: In § 108 GWB sollen die Tatbestandsvoraussetzungen für In-House-Vergaben und Formen öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit weiter geschärft werden. Tendenziell werden dabei bislang bestehende Meinungsstreitigkeiten innerhalb der Lehre und Rechtsprechung zugunsten einer breiten Zulässigkeit verschiedener ausschreibungsfreier Zusammenarbeitsformen entschieden. Dabei wird in der Begründung explizit auch auf die Ermöglichung von effektiven IT-Kooperationen (u.a. über das Modell der „Einer für alle“-Leistungen) verwiesen.
Entbürokratisierung von Vergabeverfahren
Auch bei den eigentlichen Verfahrensregelungen stehen die Themen Flexibilisierung und Vereinfachung im Vordergrund, auch wenn die Änderungen hier deutlich weniger weit gehen. U.a. ist vorgesehen:
- Wegfall des Erfordernisses „erschöpfender“ Leistungsbeschreibungen.
- Stärkung des Vorrangs von Eigenerklärungen; darüberhinausgehende Unterlagen sollen erst im Verlauf des Verfahrens von den aussichtsreichen Bewerbern bzw. Bietern gefordert werden können.
- Anerkenntnis des für offene Verfahren schon heute in der Praxis weit verbreiteten „vereinfachten Wertungsvorgangs“, bei dem die inhaltliche Prüfung der Angebote vor der Eignungsprüfung durchgeführt wird.
- Entschlackung der Vergabeunterlagen: Im Entwurf wird auch eine Rechtsprechung des OLG Düsseldorf aufgegriffen, nach der Unterlagen, die für die grundsätzliche Entscheidung für oder gegen eine Verfahrensteilnahme nicht entscheidend sind, nicht zu den Vergabeunterlagen gehören, die zwingend vom Beginn des Vergabeverfahrens an veröffentlicht werden müssen. Als Beispiele nennt die Begründung des Entwurfs „konkrete Vertragsunterlagen oder in zweistufigen Verfahren nachrangige Unterlagen für die Angebots- oder Verhandlungsphase“.
Neuer Umgang mit Drittstaaten-Bietern
In der Diskussion rund um die Öffnung von öffentlichen Vergabemärkten war der Umgang mit Drittstaaten-Bietern (also Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern ohne Marktzugangsabkommen) immer wieder ein juristischer Zankapfel. Der EuGH hat 2024 klargestellt, dass das europäische Vergaberecht gerade keinen Anspruch auf Gleichbehandlung für diese Bieter kennt. Der Gesetzgeber setzt dies nun konsequent um: Mit Anpassungen am GWB sollen die Möglichkeiten erweitert werden, Bieter aus solchen Staaten ohne große formale Hürden von Verfahren auszuschließen und/oder sie im Verfahren ungleich gegenüber EU-Anbietern zu behandeln.
Stärkung der Chancen für Startups und Innovationen
Ein Novum ist die gezielte Stärkung von jungen und innovativen Unternehmen, u.a. durch folgende Maßnahmen:
- Angemessene Eignungskriterien und-nachweise: Auftraggeber sollen verpflichtet werden, ihre Eignungsanforderungen angemessen sowie so zu konzipieren, dass sie im Grundsatz auch für Startups oder kleine Betriebe erfüllbar sind.
- Zulassung alternativer Nachweise: Die Festschreibung von Möglichkeiten, alternative Nachweise für den Beleg der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit vorlegen zu dürfen, soll verhindern, dass Startups wegen formaler Anforderungen von vornherein außen vor bleiben.
- Senkung von Liquiditätsrisiken für Auftragnehmer: Um das Liquiditätsrisiko für Startups und KMU zu senken, soll eine Zahlungsfrist von 30 Tagen nach Rechnungseingang gesetzlich festgeschrieben; zudem sollen öffentliche Auftraggeber zur Prüfung von Voraus- oder Abschlagszahlungen angehalten werden.
- Berücksichtigung von Startups in Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb: Auftraggeber sollen in Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ausdrücklich auch junge sowie kleine und mittlere Unternehmen zur Angebotsabgabe auffordern – allerdings ohne drittschützende Wirkung für die betroffenen Unternehmen.
- Stärkung von Nebenangeboten: Auftraggeber sollen zukünftig zudem ausdrücklich festlegen müssen, ob Nebenangebote zugelassen, vorgeschrieben oder ausgeschlossen sind; das Thema darf also nicht mehr einfach „ausgeblendet“ werden. Hierdurch erwartet sich die Bundesregierung eine Stärkung innovativer Lösungsanbieter und eine Förderung innovativer Lösungen.
Rechtsschutz: Ein Paradigmenwechsel – und Anlass zur Kritik
Der vielleicht bedeutendste und sicherlich der umstrittenste Einschnitt betrifft den Rechtsschutz der Bieter: Künftig soll die sogenannte aufschiebende Wirkung einer sofortigen Beschwerde gegen ablehnende Entscheidungen der Vergabekammer entfallen, ebenso das vorläufige Zuschlagsverbot. Das bedeutet: Ein vor der Vergabekammer unterlegener Bieter kann zwar noch zum Oberlandesgericht gehen – der Zuschlag wird aber trotz offener Gerichtsentscheidung regelmäßig sofort erteilt werden, ohne dass dies bei späterem Erfolg des Bieters rückgängig gemacht werden könnte. Im Ergebnis bliebe dann nur noch die – für Anbieter jedoch wenig attraktive und rechtlich wie praktisch schwerer durchsetzbare – Option von Schadensersatz. Die Kritik hieran ist erheblich, weil dadurch die gerichtliche Kontrolle von Vergabekammerentscheidungen beschnitten wird. Langfristig kann das zu weniger Rechtssicherheit führen und das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit beeinträchtigen.
Weitere (weniger umstrittene) beabsichtigte Änderungen beim Rechtsschutz betreffen etwa die Zulässigkeit von Videoverhandlungen vor den Vergabekammern, die Ausweitung der Tatbestände, unter denen ein Nachprüfungsverfahren ohne mündliche Verhandlung nach Lage der Akten entschieden werden kann, sowie die Rechtsfolgen eines erfolgreichen Nachprüfungsantrags gegen eine sogenannte De-facto-Vergabe.
Weitere Neuerungen im Überblick
Der Entwurf enthält darüber hinaus zahlreiche weitere Änderungsvorhaben, u.a. für die KonzVgV, die VSVgV, die Vergabestatistikverordnung, das LNG-Beschleunigungsgesetz, die Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung und das Personenbeförderungsgesetz. Außerdem ergeben sich Folgeänderungen für das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, das Mindestlohngesetz und das Arbeitnehmer-Entsendegesetz.
Fazit und Ausblick
Mit dem Entwurf des Vergabebeschleunigungsgesetzes wagt der Gesetzgeber einen Schritt zur Modernisierung und Effizienzsteigerung der öffentlichen Auftragsvergabe. Die beabsichtigten Entlastungen und Innovationsimpulse dürften für die Praxis auch durchaus spürbar sein, auch wenn der Entwurf in einigen Punkten – wie beim Losbildungsgebot und vor allem bei der Berücksichtigung von Umwelt- und Klimaschutzaspekten bei der Beschaffung – hinter dem Entwurf eines Vergabetransformationspakets der Vorgängerregierung zurückbleibt.
Größter Kritikpunkt an dem Reformvorhaben: Vor allem mit Blick auf den Bieterrechtsschutz droht ein Verlust an gerichtlicher Kontrolle und damit ein schärferes Ungleichgewicht zwischen öffentlichen Auftraggebern und teilnehmenden Unternehmen. Das ist nicht nur für die Anbieterseite ein Problem, sondern auch für die öffentliche Hand, die schließlich auf Angebote von (motivierten) Anbietern und damit eine Attraktivität als Kunde angewiesen ist. Durch eine geringere Prüfdichte der Oberlandesgerichte droht außerdem eine weitere Zersplitterung der Vergaberechtsprechung in den einzelnen Bundesländern.
Das nach der Sommerpause im September startende parlamentarische Verfahren wird zeigen, wie tragfähig der Gesetzentwurf ist und ob es noch Nachbesserungen geben wird. Das Inkrafttreten der Vergabenovelle ist aktuell für den 01.01. oder 01.04.2026 vorgesehen. Wer im Vergabemarkt unterwegs ist, sollte die Entwicklungen aufmerksam begleiten und sich frühzeitig auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen.
Haben Sie Fragen im Zusammenhang mit der anstehenden Novellierung des Vergaberechts? Wir beraten Sie gerne! Und schauen Sie sonst doch auch mal auf unserer Veranstaltungsseite vorbei.