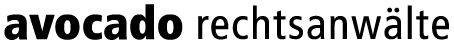OLG Stuttgart: Tücken der Eignungsleihe bei der Energiekonzessionsvergabe
Die Eignung im Rahmen der Energiekonzessionsvergabe nach § 46 EnWG
Bei der Vergabe von Energiekonzessionen haben Gemeinden die Eignung der Bewerber zu prüfen. Für die Festlegung der Eignungsanforderungen gesteht ihnen die Rechtsprechung – wie auch für die Ausgestaltung der Kriterien – einen Gestaltungsspielraum zu. Typischerweise stellen Kommunen darauf ab, ob der Bewerber über eine Netzbetriebsgenehmigung nach § 4 EnWG verfügt. Die Genehmigung bezieht sich jeweils auf ein konkretes Netzgebiet und ist bei der Aufnahme des Betriebs für das jeweilige Gebiet gesondert zu beantragen. Der Bestandsbetreiber verfügt für gewöhnlich bereits über eine solche Genehmigung für das ausgeschriebene Konzessionsgebiet. Andere etablierte Netzbetreiber, die ihre personelle, technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit auch für den Betrieb des betreffenden Netzes nachweisen können, erhalten im Bedarfsfall eine solche Genehmigung.
Schwieriger wird der Nachweis der Eignung – und deren Beurteilung durch die ausschreibende Gemeinde – bei Bewerbern, die aktuell (noch) gar kein Strom- bzw. Gasnetz betreiben. Klassischerweise anerkannt ist die Eignungsleihe beim Pachtmodell. Hier wird der Pächter als Netzbetreiber über die erforderliche Genehmigung verfügen – oder die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für den Erhalt einer solchen Genehmigung nachweisen können – und die so nachgewiesene Eignung dem Bieter als Verpächter „leihen“.
Weicht das der Eignungsleihe zugrunde liegende Modell vom klassischen Pachtmodell ab, sind für die Eignung einige Besonderheiten zu beachten. Dazu hat sich jüngst das OLG Stuttgart in seinem – bislang nicht veröffentlichten – Urteil vom 17.07.2025 (Az. 2 U 150/24) geäußert.
Entscheidung des OLG Stuttgart
In besagter Entscheidung hat das OLG Stuttgart den Ausschluss eines Bieters vom Verfahren aufgrund dessen fehlender Eignung bestätigt. Die Gemeinde hatte zum Nachweis der Eignung entweder die Vorlage einer Netzbetriebsgenehmigung nach § 4 EnWG oder eine Reihe von Einzelnachweisen gefordert.
Der betreffende Bewerber konnte im Zeitpunkt der – nach Auffassung des OLG Stuttgart in einem der Auswahlentscheidung vorgeschalteten Verfahren durchzuführenden – Eignungsprüfung keine Betriebsgenehmigung nach § 4 Abs. 1 EnWG vorlegen. Eine solche wurde zwar später nachgereicht, wurde aber – nach Auffassung des OLG Stuttgart zu Recht – nachträglich nicht mehr berücksichtigt.
Eignungsleihe und die besonderen Voraussetzungen bei Einschaltung einer Betriebsführungsgesellschaft
Im Zeitpunkt der Eignungsprüfung berief sich der Bewerber im Wege der Eignungsleihe auf die Leistungsfähigkeit einer Betriebsführungsgesellschaft. Auch dies genügte nach Auffassung des OLG Stuttgart für den Nachweis der Eignung nicht. Zwar sei eine Eignungsleihe grundsätzlich zulässig. Der Netzbetreiber – der im entschiedenen Fall im Unterschied zum Pachtmodell identisch war mit dem Bieter – müsse jedoch drei Voraussetzungen erfüllen:
- Der Dritte (Eignungsverleiher) müsse über eine Genehmigung nach § 4 Abs. 1 EnWG verfügen oder im Zeitpunkt der Aufnahme des Netzbetriebs die Voraussetzungen der Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 EnWG erfüllen;
- es müsse sichergestellt sein, dass die Leistungsfähigkeit des Dritten (Eignungsverleihers) dem Netzbetreiber während der Laufzeit des Konzessionsvertrages zur Verfügung steht (wobei es das OLG Stuttgart nicht für erforderlich hält, dass bereits im Zeitpunkt der Bewerbung ein fertig ausgehandelter und unter der Bedingung der Konzessionserteilung geschlossener Vertrag besteht) und
- schließlich müsse „sichergestellt sein, dass der Netzbetreiber selbst trotz der Eignungsleihe über die ausreichenden personellen, wirtschaftlichen und technischen Ressourcen sowie Einwirkungsmöglichkeiten auf den Dritten verfügt, die es ihm ermöglichen, die erforderliche Kontrolle und Überwachung des Dritten im Rahmen der dem Netzbetreiber zukommenden Letztverantwortung auszuüben“.
Keine Eignungsleihe für die Kontrolle und Überwachung der Betriebsführungsgesellschaft durch den Netzbetreiber
Im konkreten Fall sah das OLG Stuttgart die dritte Voraussetzung nicht als erfüllt an. Der als Netzbetreiber vorgesehene Bieter verfüge „nicht über das nötige Fachpersonal, um die Kontrolle und Überwachung der Betriebsführungsgesellschaft vornehmen zu können“. Es sei „deswegen bereits jetzt absehbar, dass die Verfügungsklägerin nicht in der Lage sein wird, die ihr zukommende Verantwortung als Netzbetreiberin im Zeitpunkt der Aufnahme des Netzbetriebs wahrzunehmen.“ Denn beim Bewerber sei „lediglich deren alleiniger Geschäftsführer vorhanden“. Insoweit sei „nicht erkennbar, inwieweit dieser in der Lage sein soll, die Kontrolle und Überwachung der Betriebsführungsgesellschaft im hier ausgeschriebenen Konzessionsgebiet [...] auszuüben“.
In den Entscheidungsgründen hat das Gericht den Unterschied des hier angebotenen Betriebsführungsmodells gegenüber dem in der Praxis etablierten Pachtmodell hervorgehoben. Während beim gegenständlich gewählten Betriebsführungsmodell der Bewerber selbst als verantwortlicher Netzbetreiber vorgesehen ist, liegt die Netzbetreiberverantwortung beim Pachtmodell in der Regel beim Pächter – einer entsprechenden Kontrolle bedarf es in diesem Fall nicht.
Eine Eignungsleihe hinsichtlich dieser Kontrolle und Überwachung sei nicht möglich, wenn der Bewerber selbst Netzbetreiber werden soll. Dies leitet das OLG Stuttgart aus § 4 Abs. 2 Satz 1 EnWG her. Etwas anderes soll sich auch nicht aus dem Rechtsgedanken der kartellvergaberechtlichen Bestimmung über die Eignungsleihe (§ 47 VgV) ergeben. Ein Nachweis über die Eignung des Bewerbers zur Kontrolle und Überwachung der Betriebsführungsgesellschaft sei deshalb erforderlich, weil der Bewerber – trotz vollständiger Eignungsleihe – selbst Netzbetreiber werden wolle. In dieser besonderen – über § 47 VgV hinausgehenden – Konstellation dürfe und müsse die ausschreibende Gemeinde im Rahmen der Prüfung der Eignung des Bieters auch prüfen, ob die Eignung nach § 4 Abs. 2 Satz 1 EnWG im Zeitpunkt der Aufnahme des Netzbetriebs voraussichtlich vorliegen werde. Hieran fehle es, „wenn der zukünftige Netzbetreiber nicht über die notwendigen wirtschaftlichen, finanziellen, technischen oder beruflichen Ressourcen verfüge, um die Kontrolle und Überwachung der – die Eignung verleihenden – Betriebsführungsgesellschaft durchführen zu können“.
Fazit und Folgen für die Praxis
Mit seiner Entscheidung schränkt das OLG Stuttgart den Gestaltungsspielraum für Angebote auf Energiekonzessionen unter Inanspruchnahme einer Eignungsleihe jenseits des klassischen Pachtmodells ein. Das Gericht betont zwar zu Recht das Erfordernis einer vollumfänglichen Eignung für den künftigen Netzbetrieb nach Maßgabe des EnWG. Es lässt aber die konkreten Anforderungen an die für die Kontrolle und Überwachung einer Betriebsführungsgesellschaft durch den Netzbetreiber erforderlichen Ressourcen offen. Von hierfür erforderlichen „wirtschaftlichen, finanziellen, technischen oder beruflichen Ressourcen“ zu sprechen, erscheint deutlich überzogen – zumal für die Kontrolle der Betriebsführungsgesellschaft allein die personellen Ressourcen relevant sein dürften.
Um nicht den Ausschluss vom Verfahren wegen fehlender Eignung zu riskieren, ist Bewerbern in derartigen Konstellationen zu empfehlen, sich für ihre Leistungsfähigkeit nicht ausschließlich auf die Eignungsleihe einer Betriebsführungsgesellschaft zu stützen, sondern selbst über die Geschäftsführung hinaus eine entsprechende Leistungsfähigkeit zur Kontrolle und Überwachung dieser Gesellschaft vorzuhalten. Ab welchem „Ausstattungsgrad“ diese hinreichend ist, dürfte sich nach den Erfordernissen des Netzbetriebs im konkreten Fall bemessen. Vorsicht ist wiederum geboten, wenn die Ausstattung des Bieters über das für die Überwachung und Kontrolle der Betriebsführungsgesellschaft erforderliche Maß hinausgeht. Erreicht diese Ausstattung einen Grad, der dem Bieter die Abgabe eines eigenständigen Angebots (ohne Einschaltung der Betriebsführungsgesellschaft) ermöglichen würde, besteht die Gefahr, dass die Beschränkung auf nur ein Angebot als wettbewerbsbeschränkende Absprache im Sinne des § 1 GWB gewertet und der Bieter vom Verfahren ausgeschlossen wird.
Für ausschreibende Gemeinden lässt sich festhalten, dass die Eignungsprüfung im Verfahren nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Kommunen sollten darauf achten, die Eignungsanforderungen im Verfahren im Rahmen ihres Gestaltungsspielraums und in Anknüpfung an die gesetzlichen Anforderungen des § 4 Abs. 2 Satz 1 EnWG klar zu definieren – und die Angebote der Bieter entsprechend sorgfältig auf deren Einhaltung zu prüfen. Dabei ist zu beachten, dass die Eignungsprüfung nach der Rechtsprechung des OLG Stuttgart einen gesonderten Prüfungsschritt darstellt, der der eigentlichen Auswahlentscheidung vorgeschaltet ist.