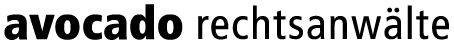Verpackungssteuer als kommunales Lenkungsinstrument zur Abfallvermeidung? – Eine Entscheidung aus Karlsruhe und ein Überblick über aktuelle Entwicklungen
Das hohe Aufkommen an Einwegverpackungen stellt Kommunen in Deutschland vor große Herausforderungen. Die Bemühungen, lokale Steuerungsinstrumente gegen Verpackungsabfälle einzusetzen, sind jüngst Gegenstand der Rechtsprechung geworden und wurden in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt: Mit Beschluss vom 27.11.2024 (Az. 1 BvR 1726/23) hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Verpackungssteuer der Stadt Tübingen für verfassungsmäßig erklärt. Der Entscheidung kommt eine erhebliche Tragweite zu, da das BVerfG damit den Grundstein dafür gelegt hat, dass Kommunen derartige Verbrauchssteuern wirksam umsetzen können. In seiner Begründung bekräftigte das BVerfG die kommunale Steuerautonomie und klärte zugleich grundlegende Fragen im Verhältnis zwischen kommunaler Steuergesetzgebung und dem Abfallrecht des Bundes.
Die Entscheidung des BVerfG hat eine Reihe neuer Entwicklungen in Gang gesetzt – vielerorts wird nun über die Einführung von Verpackungssteuern diskutiert, während Bayern mit einem geplanten Verbot solcher Steuern offensichtlich einen Sonderweg verfolgt.
Sachverhalt
Die Stadt Tübingen erhebt seit dem 01.01.2022 auf Grundlage einer kommunalen Satzung eine so genannte Verpackungssteuer auf bestimmte Einwegverpackungen, Geschirrteile und Besteck, die bei der Abgabe von Speisen und Getränken zum unmittelbaren Verzehr verwendet werden – sei es vor Ort oder „to-go“. Die Steuersätze betragen 0,50 € je Verpackung bzw. Geschirrteil sowie 0,20 € je Besteckteil, wobei maximal 1,50 € pro Einzelmahlzeit erhoben werden. Die Maßnahme zielt ausdrücklich auf eine Lenkungswirkung ab: Die Steuerpflichtigen sollen durch die finanzielle Belastung veranlasst werden, entweder auf Mehrweglösungen umzustellen oder Rücknahmesysteme zu etablieren.
Die Steuer wurde zunächst vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit der Begründung für unwirksam erklärt, dass der örtliche Verbrauch nach Art. 105 Abs. 2a Grundgesetz (GG) in der Satzungsgrundlage nicht hinreichend normiert sei – insbesondere bei „take-away“-Verkäufen könne nicht von typischem Verbrauch im Gemeindegebiet ausgegangen werden. Eine Franchise-Nehmerin einer Schnellrestaurantkette reichte daraufhin beim BVerfG Verfassungsbeschwerde ein.
Wesentliche Erwägungen des Gerichts
Das BVerfG wies die Verfassungsbeschwerde zurück und bestätigte sowohl die formelle als auch die materielle Verfassungsmäßigkeit der Satzung.
Das BVerfG stellte zunächst klar, dass die Tübinger Verpackungssteuer in die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufsfreiheit der Abgabepflichtigen eingreift. Der objektiv berufsregelnde Charakter der Maßnahme für den Endverkäufer liege auf der Hand: Die Abgabe ziele auf eine Verhaltenslenkung im betrieblichen Alltag der betroffenen Unternehmen ab. Gleichwohl sei dieser Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Die Stadt verfolge mit der Steuer ein legitimes Ziel von erheblichem Gewicht – namentlich den Schutz der Umwelt durch Abfallvermeidung. Die Maßnahme sei geeignet, erforderlich und angemessen. Eine erdrosselnde Wirkung der Steuer sei nicht substantiiert dargelegt und angesichts der Abwälzbarkeit auf die Endkunden sowie bestehender Alternativen (Mehrweg, Rücknahme) nicht ersichtlich. Schließlich sollten die Endverkäufer aufgrund der finanziellen Belastungen, die für sie aus der ihnen auferlegten Steuerpflicht folgen, zu Änderungen ihrer beruflichen Tätigkeit veranlasst werden.
Im Zentrum der Begründung stand auch die Frage nach der Gesetzgebungskompetenz. Das BVerfG qualifiziert die Verpackungssteuer als örtliche Verbrauchsteuer im Sinne des Art. 105 Abs. 2a GG. Der steuerliche Anknüpfungspunkt sei der Verbrauch von Einwegartikeln im Gemeindegebiet – und eben nicht die unternehmerische Leistung, wie etwa bei der Umsatzsteuer.
Entscheidend für die Steuergesetzgebungskompetenz nach Art. 105 Abs. 2a GG sei der Ortsbezug des Verbrauchs. Diesen sieht das Gericht auch bei Take-away-Produkten als gegeben an. Maßgeblich sei die Beschaffenheit der Ware – insbesondere Temperatur, Konsistenz und Frische –, die einen kurzfristigen Verzehr nahelege. Selbst wenn der Verzehr nicht unmittelbar am Ort des Erwerbs erfolgt, sei doch typischerweise von einem Konsum der Speisen im Gemeindegebiet auszugehen.
Bedeutsam an der Entscheidung des Gerichts ist darüber hinaus die Auseinandersetzung mit der Einbettung der Verpackungssteuer in die abfallrechtliche Gesamtkonzeption. Die Kasseler Verpackungssteuer war 1998 noch daran gescheitert, dass das damalige Abfallrecht ein sogenanntes „Kooperationsprinzip“ vorsah. Danach sollten die abfallrechtlich festgelegten Ziele der Vermeidung, Verringerung und Verwertung von Abfällen nicht ordnungsrechtlich oder durch individuelle Maßnahmen, sondern vorrangig durch die Wirtschaft in eigenverantwortlichem Zusammenwirken umgesetzt werden. Dieses Prinzip ist im heutigen Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht mehr enthalten – eine zentrale Weichenstellung für die Verpackungssteuer, die das BVerfG ausdrücklich hervorhebt.
Bayerischer Sonderweg: Verbot der kommunalen Verpackungssteuer
Während einige Kommunen in Deutschland bereits Verpackungssteuern als kommunales Instrument zur Abfallvermeidung eingeführt oder geplant haben, geht Bayern einen anderen Weg: Die Bayerische Staatsregierung hat angekündigt, die Erhebung kommunaler Verpackungssteuern durch Landesrecht gezielt zu unterbinden. Der Ministerrat hat im Mai 2025 beschlossen, die Erhebung einer solchen Steuer im Freistaat grundsätzlich abzulehnen. Im Juni folgte ein Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes, der es Kommunen künftig ausdrücklich untersagen soll, eine Verpackungssteuer zu erheben. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes werden sämtliche Anträge bayerischer Kommunen nach Aussage des Bayerischen Innenministers bereits jetzt zurückgewiesen. Dadurch entsteht mit Blick auf Bayern eine heterogene Rechtslage innerhalb Deutschlands – zugleich ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Bundesländer dem bayerischen Beispiel folgen.
Fazit und Praxishinweise
Die Entwicklung der Verpackungssteuer in Deutschland steht exemplarisch für das Zusammenspiel von kommunaler Gestaltungsfreiheit und bundesgesetzlichem Ordnungsrahmen. Für Kommunen, die angesichts zunehmender Einwegmüllbelastung nach rechtssicheren Steuerungsinstrumenten suchen, bietet die Entscheidung des BVerfG nunmehr eine belastbare Grundlage. In Köln und Freiburg werden entsprechende Konzepte bereits geprüft und sollen in absehbarer Zeit in Kraft treten. Laut einer aktuellen Studie der Deutsche Umwelthilfe e.V. interessieren sich bereits 144 Gemeinden für die Einführung einer Verpackungssteuer.
Für betroffene Unternehmen ist es nun besonders wichtig, die lokalen Regelungen im Blick zu behalten und ihre Verpackungsstrategien anzupassen, indem sie auf Mehrwegverpackungen umstellen oder Rücknahmesysteme etablieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, rechtlich gegen die Steuer vorzugehen, etwa durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen einen Steuerbescheid oder die Anrufung der Verwaltungsgerichte, sofern generelle Zweifel an der Rechtmäßigkeit der kommunalen Satzung bestehen.
Haben Sie Fragen im Zusammenhang mit der Verpackungssteuer oder weiteren abfallrechtlichen Themen? Sprechen Sie uns gerne jederzeit an!