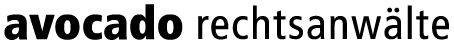Neuberechnung des sektorübergreifenden Korrekturfaktors für Zuteilung der Emissionszertifikate gefordert
Mit ihren Schlussanträgen vom 12.11.2015 hat Generalanwältin Juliane Kokott beim Europäischen Gerichtshof („EuGH“) viele überrascht. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Europäische Kommission den einheitlichen sektorübergreifenden Korrekturfaktor (Cross Sectoral Correction Factor) für die im Zeitraum 2013 bis 2020 kostenlos zuzuteilenden Emissionszertifikate für Anlagenbetreiber in ihrem Beschluss 2013/448/EU rechtmäßig festgelegt hat, hält die Generalanwältin die Festlegung des Faktors durch die Kommission mangels ausreichender Begründung für ungültig und den Kürzungsfaktor für die Zuteilung für zu niedrig. Eine Vielzahl von Unternehmen hatte hingegen auf eine Mehrzuteilung an Treibhausemissionszertifikaten gehofft. Nach Auffassung der Generalanwältin habe die Kommission den Faktor falsch berechnet, so dass dieser nun neu zu berechnen sei. In der Zwischenzeit bis zu dieser Neuberechnung soll – so der Antrag der Generalanwältin – der in Art. 4 und Anhang II des Kommissionsbeschlusses 2013/448/EU festgelegte alte Korrekturfaktor fortgelten.
Hintergrund
Insbesondere unter Verweis auf Berechnungs- und Verfahrensfehler sowie eine unzureichende Begründung durch die Europäische Kommission hatten mehrere Unternehmen vor den Gerichten ihrer Heimatstaaten geklagt, um eine Verringerung des hoch angesetzten Korrekturfaktors bei den Emissionszertifikaten zu erreichen. Daraufhin hatten mehrere Gerichte dem EuGH eine Reihe von Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, in denen es im Kern um die Gültigkeit des Kommissionsbeschlusses 2013/448/EU geht.
Vorschlag der Generalanwältin
In sieben verbundenen Verfahren hat die Generalanwältin dem EuGH am 12.11.2015 in ihren Schlussanträgen Folgendes vorgeschlagen:
- Die Festlegung des Korrekturfaktors in Art. 4 und Anhang II des Kommissionsbeschlusses 2013/448/EU wird für nichtig erklärt.
- Der bisherige Korrekturfaktor aus diesem Beschluss wird jedoch aufrechterhalten, bis die Kommission einen neuen Beschluss erlassen hat. Als Frist hierfür hat die Generalanwältin ein Jahr vorgeschlagen.
- Der neue Beschluss soll nicht auf Zuteilungen angewendet werden, die vor seinem Erlass erfolgt sind.
Formelle Rechtmäßigkeit
Die Generalanwältin hat erhebliche Zweifel an der formellen Rechtmäßigkeit des Kommissionsbeschlusses 2013/448/EU. So hält sie die Begründung der Festlegung des Korrekturfaktors für unzureichend und diese deshalb für ungültig. Auch habe der Beschluss nicht alle erforderlichen Daten enthalten, auf die die Kommission ihre Berechnung gestützt hat. Zudem habe die Kommission nach entsprechenden Anfragen sogar den Zugang zu den Daten verweigert. Im Hinblick auf die Berechnung des Korrekturfaktors sei daher einem umfassenden Rechtsschutz die Grundlage entzogen. Die Kommission müsse daher eine neue Entscheidung treffen und diese hinreichend begründen.
Materielle Rechtmäßigkeit
Nach Auffassung der Generalanwältin hat die Kommission den sogenannten Industrieplafond zu hoch festgelegt, indem sie bei der Berechnung der Emissionen Anlagenaktivitäten berücksichtigt habe, die selbst dem System erst seit dem Jahr 2013 unterworfen sind, während die Anlagen an sich vor 2013 bereits von dem System erfasst waren. Vielmehr sei es nach der Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EU nur zulässig, Emissionen von Anlagen zu berücksichtigen, die dem System seit 2013 neu unterworfen sind. Aktivitäten in bereits erfassten Anlagen hingegen müssten unberücksichtigt bleiben. Keine Bedenken hingegen hat die Generalanwältin gegen die Nichtberücksichtigung der Stromerzeugung aus Restgasen und der Kraft-Wärme-Kopplung.
Rechtslage zu Neuerlass
Eigentlich würde eine Nichtigerklärung des Korrekturfaktors dazu führen, dass er nicht mehr angewendet wird und infolgedessen Anlagenbetreiber höhere Zuteilungen erhalten. Der Antrag der Generalanwältin sieht jedoch vor, dass der bisherige Korrekturfaktor aus dem Beschluss 2013/448/EU bis zur Berechnung des neuen Faktors fortgelten soll. Die Generalanwältin begründet dies damit, dass zusätzliche kostenlose Zuteilungen, die durch die Nichtigkeitserklärung bedingt würden, „offensichtlich unangemessen“ seien, weil die Zuteilung insgesamt zu hoch ausgefallen sei. Der neue Beschluss mit dem neu berechneten Faktor soll zudem nicht auf Zuteilungen angewendet werden, die vor seinem Erlass erfolgt sind. Die Zuteilungen sollen – so die Generalanwältin – also nicht rückwirkend gekürzt werden, weil dies das berechtige Vertrauen vieler Anlagenbetreiber in den Bestand der endgültigen Zuteilung beeinträchtigen würde. Außerdem seien diese Unternehmen für die Zeit zwischen dem noch ausstehenden Urteil des EuGH und dem Erlass eines neuen Kommissionsbeschlusses insoweit einem unverschuldeten Kostenrisiko ausgesetzt, dass die künftigen kostenlosen Zuteilungen unter dem Vorbehalt von Kürzungen ergingen.
Fazit und Ausblick
Nach diesen Schlussanträgen der Generalanwältin sind die Erfolgschancen für die Klagen der europäischen Industrie zur Anwendung des sektorübergreifenden Korrekturfaktor bei der kostenlosen Zuteilung der Emissionszertifikate für die Jahre 2014 bis 2020 jedenfalls nicht sehr hoch. Denn erfahrungsgemäß folgt der Europäische Gerichtshof den Anträgen der Generalanwälte häufig, auch wenn er formal hieran nicht gebunden ist.
Nicht wenige Anlagenbetreiber in Deutschland werden die Entscheidung des EuGH mit großer Spannung erwarten. So sind nach Angaben der Deutschen Emissionshandelsstelle („DEHSt“) derzeit etwa 700 zumeist ruhend gestellte Widerspruchsverfahren anhängig, die den sektorübergreifenden Korrekturfaktor angreifen. Für diese Anlagenbetreiber empfiehlt es sich zunächst, diese Widersprüche aufrechtzuerhalten, bis die Entscheidung des EuGH ergangen ist. Mit einer Entscheidung des EuGH ist jedoch frühestens erst im Frühjahr 2016 zu rechnen.