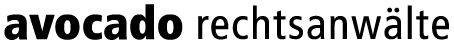Bau- und Architektenrecht aktuell
Eine aktuelle Entscheidung des BGH (Urteil vom 08.08.2019 – VII ZR 34/18) hat die Fachwelt aufhorchen lassen! Für die Bemessung des neuen Einheitspreises bei Mehrmengen im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B sind danach die tatsächlich erforderlichen Kosten zzgl. angemessener Zuschläge maßgeblich, wenn vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Damit hat der BGH der bislang herrschenden Auffassung in der obergerichtlichen Rechtsprechung und Literatur, wonach bei der Preisbildung nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B die ursprüngliche Kalkulation des Auftragnehmers zu berücksichtigen ist und ihre Einzelbestandteile unter Berücksichtigung der Mehr- und Minderkosten vorzuschreiben sind (vorkalkulatorische Preisfortschreibung), eine klare Absage erteilt.
Diese und noch weitere ebenso interessante wie praxisrelevante Entscheidungen zum Bau- und Architektenrecht stellen wir Ihnen in unserem neuen Newsletter vor.
Haben Sie Fragen? Fragen Sie uns!
1. Neuer Einheitspreis bei Mengenmehrungen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B durch ergänzende Vertragsauslegung zu ermitteln
Haben die Parteien keine Vereinbarung getroffen, wie der neue Einheitspreis bei Mengenmehrungen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B zu ermitteln sei, enthalte der Vertrag eine Lücke. Diese Lücke sei im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen. Dabei ergebe die vorzunehmende Abwägung der beiderseitigen Interessen der Parteien regelmäßig, dass für die Bemessung des neuen Einheitspreises die tatsächlich erforderlichen Kosten zzgl. angemessener Zuschläge maßgeblich seien, so der BGH in seinem Urteil vom 08.08.2019 – VII ZR 34/18.
Der Auftragnehmer war in diesem Fall unter Einbeziehung der VOB/B mit Abbrucharbeiten beauftragt. Bei einer mit 1 t ausgeschriebenen Entsorgungsposition kam es zu erheblichen Mengenmehrungen. Es mussten tatsächlich 83,92 t entsorgt werden. Der klagende Auftragnehmer begehrte für die Mengenmehrung 462,00 Euro pro Tonne netto und begründete dies mit dem in der Urkalkulation angebotenen Preis. Der beklagte Auftraggeber verlangte wegen der Mehrmengen die Vereinbarung eines neuen Preises und Auskunft über die tatsächlichen Kosten der Entsorgung. Diese bezifferte der Auftragnehmer mit 150,40 Euro pro Tonne netto (92,00 Euro pro Tonne netto, einem 20-prozentigen GU-Zuschlag sowie 40,00 Euro netto Verladekosten). Im Berufungsverfahren machte der klagende Auftragnehmer einen Vergütungsanspruch von 406,00 Euro pro Tonne netto geltend. Das Berufungsgericht sprach ihm allerdings nur 150,40 Euro pro Tonne netto zu. Dagegen wendete sich die Revision.
Der BGH bestätigte, dass der Auftragnehmer über den ihm zugesprochenen Betrag von 150,40 Euro pro Tonne netto hinaus keine weitere Vergütung verlangen kann. Er begründete seine Entscheidung damit, dass § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B nicht regele, wie die Vergütungsanpassung bei Mengenmehrungen vorzunehmen sei. Hätten die Parteien keine vertragliche Vereinbarung getroffen, nach welchen Kriterien oder Faktoren ein neuer Einheitspreis bestimmt werden solle, enthalte der Vertrag eine Lücke, die im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung nach §§ 133, 157 BGB zu schließen sei. Entscheidend sei demnach, was die Vertragsparteien bei angemessener Abwägung ihrer Interessen nach Treu und Glauben als redliche Vertragspartner vereinbart hätten, wenn sie den nicht geregelten Fall bedacht hätten. Der BGH geht dabei davon aus, dass durch die Anknüpfung an die tatsächlichen Kosten zzgl. angemessener Zuschläge keine der Vertragsparteien eine ungewollte Besser- oder Schlechterstellung erfahre. Der Auftragnehmer erhalte so für die relevanten Mehrmengen eine auskömmliche Vergütung. Die Anknüpfung an die tatsächlich erforderlichen Kosten zzgl. angemessener Zuschläge führe zu einem redlicheren Ergebnis als dies eine vorkalkulatorische Preisfortschreibung täte. Die Regelung des § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B sehe nach ihrem Wortlaut nicht vor, dass der für die ursprünglich erwartete Ausführungsmenge vereinbarte Preis, wenn auch in angepasster Form, für die diesen Rahmen überschreitende Ausführungsmenge fortgelten solle. Vielmehr könne der neue Einheitspreis selbständig und losgelöst davon bestimmt werden.
2. Die Mindest- und Höchstsätze der HOAI verstoßen gegen europäisches Recht
Der EuGH hat in seinem Urteil vom 04.07.2019, RS. C-377/17, entschieden, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel 15 Abs. 1, 2. Buchstabe g) und Abs. 3 Richtlinie 2006/123/EG verstoßen hat, indem sie verbindliche Honorare für die Planungsleistung von Architekten und Ingenieuren beibehalten hat.
In der sogenannten Dienstleistungsrichtlinie ist seit Ende 2006 geregelt, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nationale Vorschriften auf den Prüfstand stellen müssen, die „die Beachtung von festgesetzten Mindest- und/oder Höchstpreisen durch den Dienstleistungserbringer“ regeln. Dadurch soll der freie Dienstleistungsverkehr sichergestellt und sollen Anbieter aus anderen Mitgliedsstaaten nicht daran gehindert werden, sich einen Markteintritt durch Preiswettbewerb zu erleichtern. Nationale Regelungen sind danach nur dann zulässig, wenn sie durch einen „zwingenden Grund des Allgemeininteresses“ gerechtfertigt und darüber hinaus verhältnismäßig sind. Diese Voraussetzung sah und sieht die EU-Kommission bei dem verbindlichen Preisrecht der HOAI als nicht gegeben an.
Der EuGH geht nun davon aus, dass die Dienstleistungsrichtlinie auch auf rein innerstaatliche Sachverhalte anwendbar sei. Die Höchstsätze der HOAI seien nicht verhältnismäßig, da als weniger einschneidende Maßnahmen auch in Betracht komme, den Kunden Preisorientierungen für die verschiedenen von der HOAI genannten Kategorien von Leistungen zur Verfügung zu stellen. Hinsichtlich der Mindestsätze der HOAI hat der EuGH zwar das Argument der Bundesregierung gelten lassen, dass diese dazu beitragen könnten, eine hohe Qualität der Planungsleistungen zu gewährleisten und die angestrebten Ziele (Qualität der Arbeiten, Verbraucherschutz, Bausicherheit, Erhaltung der Baukultur, ökologisches Bauen) zu erreichen. Die Mindestsätze würden aber nicht in kohärenter und systematischer Weise verfolgt werden, da in Deutschland Planungsleistungen von Dienstleistern erbracht werden könnten, die nicht ihre entsprechende fachliche Eignung nachgewiesen hätten.
Die Entscheidung des EuGH ist nicht anfechtbar. Sie führt aber nicht dazu, dass die gesamte HOAI unwirksam ist. Die übrigen Regelungen der HOAI, z. B. die Regelungen zur Preisermittlung für verschiedene Leistungsbilder und Leistungsphasen anhand von anrechenbaren Kosten, bleiben von dieser Entscheidung und deren Rechtsfolgen unangetastet. Nur der verbindliche Preisrahmen der Höchst- und Mindestsätze ist mithin unanwendbar. Es bleibt abzuwarten, ob und wie der deutsche Gesetzgeber jetzt binnen eines Jahres dieses Urteil umsetzt.
3. HOAI-Mindestsätze sind trotz EuGH-Urteil bindend
Trotz des EuGH-Urteils vom 04.07.2019 kann sich ein Ingenieur auf eine Unterschreitung der Mindestsätze gemäß § 7 HOAI berufen. Das hat das OLG Hamm, Urteil vom 23.07.2019 – 21 U 24/18 (nicht rechtskräftig), entschieden.
Mit Ingenieurvertrag beauftragte der Besteller den Auftragnehmer (ein Ingenieurbüro) mit Leistungen der technischen Gebäudeausrüstung. Vereinbart wurde ein Pauschalhonorar. Nach Kündigung durch den Auftragnehmer wegen Zahlungsverzugs des Bestellers erstellte der Auftragnehmer eine Schlussrechnung auf Basis der Mindestsätze der HOAI und klagte die Honorardifferenz ein mit der Begründung, die vertraglich vereinbarte Pauschale unterschreite den Mindestsatz nach HOAI, sodass ihm nach § 7 Abs. 5 HOAI 2013 das Mindestsatzhonorar zustehe.
Dem Ansinnen ist das OLG Hamm nicht gefolgt. Es geht davon aus, dass das Urteil des EuGH im Vertragsverletzungsverfahren nur den Mitgliedstaat binde und keine Rechtswirkung zu Lasten (privater) Einzelner entfalte. Der Auffassung des OLG Hamm hat sich aktuell auch das Kammergericht Berlin im Beschluss vom 19.08.2019 – 21 U 20/19 (nicht rechtskräftig) – angeschlossen.
Die Obergerichte reagieren jedoch unterschiedlich auf die Entscheidung des EuGH vom 04.07.2019, nach der die Mindestsätze der HOAI gegen EU-Recht verstoßen. So hat das OLG Celle in seinem Urteil vom 23.07.2019 – 14 U 182/18 – die Mindestsatzfiktion des § 7 Abs. 5 HOAI als gegenstandslos eingestuft und festgestellt, dass es durch die EuGH-Entscheidung nicht mehr zulässig sei, getroffene Honorarvereinbarungen an den Mindest- und Höchstsätzen der HOAI zu messen. In diesem Sinne hat zuletzt auch das OLG Düsseldorf in seinem Beschluss vom 17.09.2019 – 23 U 155/18 – festgestellt, dass das Preisrahmenrecht der HOAI nach der EuGH-Entscheidung vom 04.07.2019 auch zwischen Privaten nicht mehr angewendet werden darf.
4. HOAI-Honorarvorgaben gelten infolge des EuGH-Urteils nicht mehr im Vergabeverfahren nach GWB und VgV
Infolge des EuGH-Urteils vom 04.07.2019 ist es öffentlichen Auftraggebern untersagt, die EU-rechtswidrigen Vorschriften der HOAI bei der Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen im Zuschlagskriterium „Preis“ anzuwenden. Das hat die VK Bund in ihrem Beschluss vom 30.08.2019
– VK 2-60/19 – entschieden.
Die Auftraggeberin schrieb im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Architekten- und Ingenieurleistungen europaweit aus. Nach dem Vertragsentwurf richtete sich die Honorarermittlung für die einzelnen Objekte bzw. Leistungen nach den Maßgaben der HOAI, wobei gut ein Drittel des Gesamthonorars durch die Tafelwerte der HOAI festgelegt wurden, während das Honorar im Übrigen mangels Einschlägigkeit der HOAI frei durch die Bieter kalkuliert werden konnte. Der Preis ging mit 30 % in die Wertung ein.
Nach Ansicht der VK Bund leidet das Vergabeverfahren an dem Mangel, dass für das Zuschlagskriterium „Preis“ und die hierfür erforderliche Honorarkalkulation durch die Bieter zumindest teilweise das verbindliche Preisrecht der HOAI anzuwenden und von der Auftraggeberin vorgegeben war. Da der EuGH in seiner Entscheidung vom 04.07.2019 festgestellt habe, dass das Beibehalten der verbindlichen Honorare für Planungsleistungen von Architekten und Ingenieuren in der HOAI gegen sekundäres EU-Recht verstoße, dürften die entsprechenden Vorgaben der HOAI bei der Honorarkalkulation zum Zuschlagskriterium „Preis“ nicht mehr angewendet werden. Daher sei das streitgegenständliche Vergabeverfahren zurückzuversetzen und den Bietern eine neue Kalkulation unter Beachtung der Maßgabe zu ermöglichen, dass im Rahmen des Zuschlagskriteriums „Preis“ auch Zu- oder Abschläge auf die Mindest- und Höchstsätze angeboten werden könnten. Nach Auffassung der VK Bund hätte die Auftraggeberin der während des laufenden Vergabeverfahrens ergangenen Entscheidung des EuGH durch Anpassung der Vergabeunterlagen Rechnung tragen müssen. Daraus folgt, dass Auftraggeber bei laufenden und zukünftigen Verfahren im Rahmen des Zuschlagskriteriums „Preis“ die Kalkulation nicht mehr an die verbindlichen Mindest- und Höchstsätze nach HOAI koppeln dürfen. Die Preiswertung bei öffentlichen Auftragsvergaben dürfte somit aufgrund der größeren Freiheit der Bieter bei der Kalkulation in Zukunft an Bedeutung gewinnen.
5. Keine Vergütung von Beschleunigungsmaßnahmen im Stundenlohn
Führt der Auftragnehmer auf Anweisung des Auftraggebers Beschleunigungsmaßnahmen aus, kann er den Aufwand nicht im Stundenlohn abrechnen, wenn keine Stundenlohnvereinbarung getroffen wurde und ihm bekannt ist, dass der Auftragnehmer grundsätzlich keine Abrechnung auf Stundenlohnbasis akzeptiert, so das OLG Dresden, Urteil vom 07.02.2017 – 9 U 1253/16 und der BGH – Beschluss vom 05.06.2019 – VII ZR 54/17 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen).
Die Parteien eines Bauvertrages vereinbarten Beschleunigungsmaßnahmen, um eine nicht vom Auftragnehmer zu vertretende Verzögerung des Bauablaufs zu kompensieren. Eine Einigung über die zu zahlende Vergütung wurde nicht getroffen. Der Auftragnehmer rechnete den ihm vom Nachunternehmer auf Stundenbasis in Rechnung gestellten Aufwand der Beschleunigungsmaßnahmen in Quadratmeterpreise um. Seine Zahlungsklage wurde mit der Begründung abgewiesen, dass keine Stundenlohnvereinbarung vorliege und dass der Auftragnehmer entweder seine Urkalkulation habe offenlegen oder die Kosten als Schaden konkret nachweisen müssen, was beides nicht geschehen sei.
Die Berufung blieb ohne Erfolg. Nachdem dem Auftragnehmer bekannt gewesen sei, dass der Auftraggeber grundsätzlich keine Stundenlohnvereinbarungen abschließe, habe er die vom Nachunternehmer angesetzten Stundenansätze nicht einfach in Quadratmeterpreise umrechnen können, da dies dazu geführt hätte, dass der Auftraggeber den vollen Stundenlohn zu zahlen habe. Nachdem der Nachunternehmer die Beschleunigungsmaßnahmen auf Stundenlohnbasis angeboten habe, hätte der Auftragnehmer den Auftraggeber entsprechend informieren müssen, damit dieser hätte abwägen können, ob er die Beschleunigungsmaßnahmen auf Stundenlohnbasis akzeptiere, so das OLG Dresden.
6. Text vor Plan oder Plan vor Text, maßgeblich ist die Auslegung der Leistungsbeschreibung
Es gibt keine allgemeine Regel, nach der Unklarheiten der Leistungsbeschreibung generell zu Lasten des Bestellers oder umgekehrt zu Lasten des Unternehmers zu lösen sind. Sei es nach der einem Vertrag zu Grunde liegenden Leistungsbeschreibung unklar, ob der Unternehmer eine bestimmte Leistung in die vereinbarte Vergütung habe einkalkulieren müssen, sei die Leistungsbeschreibung aus der Sicht einer objektiven Vertragspartei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auszulegen, so dass Kammergericht Berlin, Urteil vom 27.08.2019 – 21 U 160/18 (nicht rechtskräftig).
Unter Einbeziehung der VOB/B erhielt der Auftragnehmer den Zuschlag für Planungs- und Bauleistungen für den Umbau eines Bahnhofs. Zu den Ausschreibungsunterlagen gehörten unter anderem ein Leistungsverzeichnis (LV) mit über 1.000 Seiten und diverse Pläne. Bei der durch den Auftragnehmer zu errichtenden Eisenbahnüberführung waren in den Plänen an den Widerlagern Magerbetonauffüllungen ausgewiesen, diese waren jedoch im entsprechenden Titel des LV nicht beschrieben. Die Abdeckungen von Randkappen der Brückenkonstruktion zur Herstellung eines Kabelkanals waren in den Plänen dargestellt, im LV aber nur für einen Teilbereich mit Positionen beschrieben. Der AN begehrte Mehrvergütung i.H.v. rund 16.000 Euro netto für den Magerbeton und rund 31.000 Euro netto für die Abdeckungen.
Das KG betätigte nur die Mehrvergütung für die Abdeckungen der Randkappen. Für die gebotene Auslegung der Leistungsbeschreibung seien nicht nur die LV, sondern auch Pläne, Zeichnungen oder sonstigen Umstände, auf die die Parteien bei der Bestimmung der auszuführenden Leistungen Bezug genommen hätten, heran zu ziehen. Es gebe keine allgemeine Regel, wonach Unklarheiten zu Lasten einer bestimmten Vertragspartei zu lösen seien. Weder lasse sich allgemein sagen, dass jede Unklarheit einen Verstoß gegen die Pflicht des AG zu möglichst erschöpfender Leistungsbeschreibung darstelle und deshalb zu seinen Lasten zu lösen sei, noch sei es richtig, eine Pflicht des Unternehmers zu postulieren, auf alle Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung hinzuweisen, so dass offengebliebene Punkte zu seinen Lasten gehen müssten. So könne der Plan dem Text vorgehen, wenn aus Sicht einer objektiven Vertragspartei dem Plan eine besondere Bedeutung für die Bestimmung der vertraglichen Leistung und ihrer Vergütung zukomme. Das sei dann der Fall, wenn es um Leistungen gehe, die für die Funktionalität der Werkleistung und die durch die Vertragserfüllung entstehenden Kosten von größerer Bedeutung seien. Denn dann sei aus Sicht einer objektiven Partei davon auszugehen, dass ein Unternehmer, der zur Erstellung eines Vertragsangebots die Leistungsbeschreibung durchgehe, sich nicht darauf beschränke, den Text der Einzelpositionen des LV zu bepreisen, sondern dass er dabei auch die Pläne zu Rate ziehe und auswerte. Sofern ihm dabei das im Textteil fehlende Element der geschuldeten Leistung auffallen müsse, bestehe für den Unternehmer Anlass, es bei der Preisbildung einzukalkulieren. Dies sei bei dem Magerbeton der Fall, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung aber nicht bei den Abdeckungen.
7. Durch RBBau-Vertragsmuster können wirksam Baukostenobergrenzen vereinbart werden
Die in den Vertragsmustern des Bundes für Verträge mit Architekten vorgesehenen Regelungen, wonach die Baukosten einen bestimmten Betrag nicht überschreiten dürfen, bestimmen eine Baukostenobergrenze und beschreiben damit einen unmittelbaren Gegenstand der Hauptleistungspflichten des Architekten. Sie seien deshalb einer AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle entzogen, so der BGH im Urteil vom 11.07.2019 – VII ZR 266/17.
Von einem Verein, dessen Satzungszweck darauf gerichtet ist, rechtmäßige Vertragskonditionen in Vertragsmustern von Bauherren durchzusetzen, wurde beantragt, dem Bund die Verwendung der folgenden Klausel zu untersagen, weil sie die Architekten unangemessen benachteilige und intransparent sei:
„Die Baukosten für die Baumaßnahme dürfen den Betrag von [... EUR brutto/... EUR netto] nicht überschreiten. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach den 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau/Hu-Bau/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine Leistung bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird.“
Der Bund verwendet wiederkehrend diese und ähnliche Klauseln in seinen Standardverträgen mit Architekten und Planern. Er verwies darauf, dass derartige Regelungen einer Baukostenobergrenze zum Kernbereich einer Leistungsbeschreibung gehörten. Die Vorinstanzen wiesen die Klage des Vereins ab.
Der BGH schloss sich diesen Entscheidungen an und wies die Revision zurück. Eine Inhaltskontrolle nach §§ 307 Abs. 1 und 2, 308, 309 BGB habe hinsichtlich der in Frage stehenden Vertragsklauseln über eine Baukostenobergrenze nicht zu erfolgen, weil es sich um Regelungen über den unmittelbaren Gegenstand der Hauptleistungspflichten des Architekten handele. Die Freistellung von der Inhaltskontrolle gelte für Abreden über den unmittelbaren Leistungsgegenstand, ohne deren Vorliegen mangels Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhaltes ein wirksamer Vertrag nicht mehr angenommen werden könne. Vereinbarten die Vertragsparteien eine Baukostenobergrenze, liege darin eine Beschaffenheitsvereinbarung der zu erreichenden Planungs- und Überwachungsziele, die der Architekt als Hauptleistungspflicht zu erfüllen habe. Er sei verpflichtet, die Planungsvorgaben des Bestellers zu den Herstellkosten des Bauwerks zu beachten und eine vereinbarte Baukostenobergrenze einzuhalten. Eine schuldhafte Nichtbeachtung dieser Beschaffenheitsvereinbarung könne zu Schadenersatzansprüchen gegen den Architekten führen.
8. Ordnungsgemäße Behinderungsanzeige als zwingende Voraussetzung für einen Anspruch auf Bauzeitverlängerung
Das OLG Oldenburg hat in seinem Urteil vom 20.08.2019 – 2 U 81/19 – zu den Anforderungen an die schlüssige Darlegung und Substantiierung von Tatsachen für einen Anspruch des Werkunternehmers auf Mehrkosten wegen Bauzeitverlängerung sowie zu den Anforderungen an Behinderungsanzeigen und deren Entbehrlichkeit gemäß § 6 Abs. 1 VOB/B Stellung genommen.
Der Auftragnehmer war mit der Durchführung von Straßenbauarbeiten beauftragt. Er sollte am 02.06.2014 mit den Bauarbeiten beginnen und diese bis zum 30.11.2014 abschließen. Allerdings waren zum vereinbarten Baubeginn bauseits noch nicht alle Vorleistungen erbracht. Am 30.06.2014 zeigte der Auftragnehmer erstmals schriftlich Behinderung an. Er behauptete, dass seine Mitarbeiter zuvor regelmäßig mündlich Bedenkenanzeigen erteilt hätten.
Nach Auffassung des OLG Oldenburg fehlte es vorliegend an einer ordnungsgemäßen Behinderungsanzeige. Diese müsse alle Tatsachen enthalten, aus denen sich für den Auftraggeber mit hinreichender Klarheit und erschöpfend die von dem Auftragnehmer benannten Hinderungsgründe ergeben. Dabei müsse der Auftragnehmer Angaben dazu machen, ob und wann seine Arbeiten, die nach dem Bauablauf nun ausgeführt werden müssten, nicht oder nicht wie vorgesehen ausgeführt werden könnten. Die bloße Behauptung des Auftragnehmers, seine Mitarbeiter hätten regelmäßig mündlich Bedenken angezeigt, reichten für eine ordnungsgemäße Behinderungsanzeige nicht aus. Sinn und Zweck der Behinderungsanzeige bestünden darin, den Auftraggeber vor der drohenden Inanspruchnahme zu warnen und ihm Gelegenheit zur Abhilfe zu schaffen. Im vorliegenden Fall sei die Behinderungsanzeige auch nicht wegen Offenkundigkeit entbehrlich. Dies ergebe sich aus dem Vortrag des Auftragnehmers ebenfalls nicht. Offenkundig und bekannt seien die hindernden Umstände nur dann, wenn der Auftraggeber nach seinem Verhalten, seinen Äußerungen und seinen Anordnungen zweifellos über die Umstände unterrichtet sei. Diese müssten so deutlich hervortreten, dass sie selbst einem bautechnischen Laien nicht verborgen hätten bleiben können.
9. Nicht immer sind Baugrundprobleme Auftraggeberprobleme
Der Auftragnehmer wird von seiner Einstandspflicht für eine fehlerhafte Ausführung einer Schottertragschicht, die zu Setzungen geführt hat, nicht deshalb befreit, weil eine den Beteiligten unbekannte weitere Ursache im tieferen Baugrund die aufgetretenen Setzungsentscheidungen begünstigt haben kann. Eine solche weitere Ursache führe jedenfalls hier auch nicht deshalb zu einer Mithaftung des Auftraggebers, weil es sich bei einem nicht erkennbaren Baugrundrisiko um seinen Risikobereich und damit seine Verantwortung handeln könne, OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.03.2019 – 21 U 118/16.
Der Auftraggeber beauftragte den Auftragnehmer mit der Herstellung einer Schottertragschicht und dem Schotterfeinplenum. Darauf verlegte der Auftraggeber Fertigbetonelemente zur Aufnahme von Gleisen. Später stellte sich heraus, dass die nach Ausführung der Arbeiten an den Betonschwellen aufgetretenen Schäden auf einen vom Auftragnehmer nicht ordnungsgemäß verdichteten Untergrund zurückzuführen waren. Der Auftragnehmer wies den Anspruch des Auftraggebers auf Mangelbeseitigungskosten unter anderem damit zurück, dass die Setzungen auf Probleme mit dem Untergrund zurückzuführen seien.
Diesem Argument folgte das OLG Düsseldorf nicht. Es ging davon aus, dass der Auftragnehmer zur Beseitigung der von ihm verursachten Mängel verpflichtet gewesen sei. Diese Haftung werde nicht dadurch ausgeschlossen, dass im tieferen Baugrund ein zusätzliches und von allen Beteiligten zunächst nicht erkennbares weiteres Risiko bestehe. Das Gericht stellte fest, dass dem Auftraggeber insoweit kein Verschulden vorgeworfen werden könne, da das Baugrundgutachten aus dem Jahr 2008 ordnungsgemäß erstellt worden sei. Auch aus dem Gesichtspunkt, dass es bei einem nicht erkennbaren Baugrundrisiko um den Risikobereich des Auftraggebers gehe, ließe sich eine Mithaftung nicht begründen, da bei der ersten Sanierung das für alle Beteiligten zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbare weitere Risiko im Baugrund unbekannt gewesen sei.