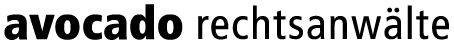Bau- und Architektenrecht aktuell
Ein neuer Einheitspreis kann bei einer Mengenmehrung über 10 % auch dann verlangt werden, wenn keine Kostenänderung vorliegt. Der Anspruch auf Vereinbarung eines neuen Preises nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B setzt nach dem Wortlaut der Klausel nur voraus, dass die ausgeführte Menge den im Vertrag angegebenen Mengenansatz um mehr als 10 % überschreitet und eine Partei die Vereinbarung eines neuen Preises verlangt. Dagegen ergibt sich aus § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B nicht, dass eine auf die Mengenmehrung kausal zurückzuführende Veränderung der im ursprünglichen Einheitspreis veranschlagten Kosten Voraussetzung für den Anspruch auf Vereinbarung eines neuen Preises ist. Dies alles ergibt sich aus einer aktuellen Entscheidung des BGH (Urteil vom 21.11.2019 – VII ZR 10/19).
Der sogenannte Lockdown zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie hat das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend heruntergefahren. Davon sind auch die Gerichte betroffen, was sich in einer deutlich geringeren Anzahl an neuen Entscheidungen bemerkbar macht.
Aber einige interessante wie praxisrelevante Entscheidungen zum Bau- und Architektenrecht gibt es dennoch, die wir Ihnen in unserem neuen Newsletter vorstellen.
Haben Sie Fragen? Fragen Sie uns!
1. Neuer Einheitspreis bei einer Mengenmehrung über 10 % auch ohne Kostenänderung
Der Anspruch auf Vereinbarung eines neuen Preises nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B setzt nach dem Wortlaut der Regelung nur voraus, dass die ausgeführte Menge den im Vertrag angegebenen Mengenansatz um mehr als 10 % überschreitet und eine Partei die Vereinbarung eines neuen Preises verlangt. Dagegen ergibt sich aus § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B nicht, dass eine auf die Mengenmehrung kausal zurückzuführende Veränderung der im ursprünglichen Einheitspreis veranschlagten Kosten Voraussetzung für den Anspruch auf Vereinbarung eines neuen Preises ist, so der BGH in einem Urteil vom 21.11.2019 (VII ZR 10/19).
Der Auftragnehmer war in diesem Fall mit der Herstellung einer Natursteinfassade einschließlich der Fassadendämmung beauftragt. Seine Schlussrechnung kürzte der Auftraggeber aufgrund von Mengenmehrungen um 162.560,00 Euro. Nach seiner Auffassung war der vereinbarte Einheitspreis um den in ihm jeweils enthaltenen Anteil der Allgemeinen Geschäftskosten herabzusetzen.
Das Kammergericht ist dieser Begründung nicht gefolgt. Ein Abschlag um den Anteil der Allgemeinen Geschäftskosten komme nicht in Betracht, weil Allgemeine Geschäftskosten zur geplanten Gesamtleistung des Auftragnehmers gehörten. Demzufolge könnten alle Herstellungskosten – auch bei Mengenmehrungen – mit Allgemeinen Geschäftskosten in Höhe des kalkulatorisch vorgesehenen Prozentsatzes beaufschlagt werden.
Der BGH hat die Entscheidung des Kammergerichts aufgehoben und den Rechtsstreit dorthin zurückverwiesen. Der Anspruch auf Vereinbarung eines neuen Einheitspreises nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B setze keine auf die Mengenänderung kausal zurückzuführende Veränderung der Kosten voraus. Voraussetzung sei lediglich die Überschreitung des angegebenen Mengenansatzes um mehr als 10 % und das Verlangen einer Preisanpassung. Lägen diese Voraussetzungen vor, sei ein neuer Einheitspreis zu vereinbaren. Könnten sich die Parteien nicht auf einen neuen Einheitspreis verständigen, sei dieser im Streitfall vom Gericht zu bestimmen. Dabei seien die im Urteil vom 08.08.2019 aufgestellten Grund-sätze zur Preisbildung zu beachten. Entgegen der auf einem Redaktionsversehen beruhenden Formulierung im Urteil vom 08.08.2019 seien Baustellengemeinkosten nicht im Rahmen angemessener Zuschläge zu berücksichtigen. Bei der Bildung des neuen Einheitspreises sei ein angemessener Zuschlag für Allgemeine Geschäftskosten auf die tatsächlich erforderlichen Kosten der über 10 % liegenden Mehrmengen zu berücksichtigen. Durch bloßen Verweis auf die Kalkulation des Auftragnehmers könne die Angemessenheit des Zuschlags für Allgemeine Geschäftskosten nicht begründet werden. Das Gericht sei bei der Bestimmung der Höhe zur Schätzung gemäß § 287 Abs. 2 ZPO berechtigt.
2. Keine erbrachte Leistung bei angelieferten, aber nicht eigebauten Bauteilen
Zu den erbrachten Werkleistungen bei einem vorzeitig beendeten Werkvertrag gehören grundsätzlich nur diejenigen Arbeiten, die sich im Zeitpunkt der Kündigung des Werkvertrages bereits im Bauwerk verkörpern. Demzufolge gehören zu den erbrachten Leistungen grundsätzlich nicht die bereits hergestellten bzw. gelieferten, aber noch nicht eingebauten Bauteile, und zwar unabhängig davon, ob sie bereits zur Baustelle geliefert wurden oder nicht, so das OLG Düsseldorf in seinem Urteil vom 13.03.2020 (22 O 222/19).
Am 17.09.2014 schlossen die Parteien einen Vertrag über die Sanierung eines Schwimmbades im Haus des Auftraggebers. Der Detailpauschalvertrag wurde vorzeitig beendet. Die Auftragnehmerin machte einen Vergütungsanspruch unter anderem für teils eingebaute und teils nicht eingebaute Bauteile/Materialien geltend.
Hinsichtlich der noch nicht eingebauten Bauteile/Materialien ist der Auftraggeber zur Bezahlung nicht verpflichtet, so das OLG Düsseldorf. Der Auftraggeber habe die Gegenstände gerade nicht durch einen Kaufvertrag erworben, sondern sie sollten im Rahmen der vereinbarten Werkleistungen durch Einbau in das Eigentum des Auftraggebers übergehen. Bei einem vorzeitig beendeten Werkvertrag gehörten grundsätzlich nur diejenigen Arbeiten zu den erbrachten Werkleistungen, die sich im Zeitpunkt der Kündigung des Werkvertrages bereits im Bauwerk verkörpern. Die bereits hergestellten bzw. gelieferten, aber noch nicht eingebauten Bauteile, gehörten daher grundsätzlich nicht zu den erbrachten Leistungen. Dies gelte unabhängig davon, ob sie bereits zur Baustelle geliefert worden seien oder nicht. Ausnahmsweise könne der Auftraggeber allerdings nach Treu und Glauben verpflichtet sein, diese noch nicht eingebauten Teile zu übernehmen und angemessen zu vergüten. Voraussetzung hierfür sei, dass der gekündigte Auftragnehmer sie selbst nicht mehr verwenden könne und die Bauteile für die Weiterführung des Bauvorhabens uneingeschränkt tauglich seien und ihre Verwendung dem Auftraggeber unter Berücksichtigung aller Umstände zugemutet werden könne. Häufig komme die Übernahme schon deshalb nicht in Betracht, weil ein Nachfolgeunternehmer keinen Vertrag schließen wolle, der ihn dazu verpflichte, diese für ihn fremden Baustoffe bzw. Bauteile zu verwenden. Im vorliegenden Fall habe die Auftragnehmerin zu diesem Punkt nicht ausreichend vorgetragen.
3. Die Verjährungsfrist für Baumängel beginnt mit endgültig verweigerter Abnahme
Der Beginn der fünfjährigen Verjährungsfrist für Baumängel ist nicht zwingend an die Abnahme der Leistung geknüpft. Die Verjährung beginnt auch dann, wenn der Auftraggeber die Entgegennahme des Werks als Erfüllung der Vertragsleistung ablehnt, indem er die Abnahme endgültig verweigert. Dies hat das OLG Dresden in seinem Beschluss vom 05.09.2017 (22 U 379/17) entschieden. Die dagegen gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde hat der BGH mit Beschluss vom 25.03.2020 (VII ZR 242/17) zurückgewiesen.
Auftraggeber und Auftragnehmer schlossen einen Bauvertrag. Es kam zu einem Streit über Mängel, in dessen Folge der Auftraggeber den Auftragnehmer mit mehreren Schreiben aufforderte, ihm Terminvorschläge zur Mangelbeseitigung zu unterbreiten. Außerdem setzte er dem Auftragnehmer eine Frist zur Mangelbeseitigung bis zum 15.07.2002 und drohte für den Fall einer Nichtreaktion an, die Mangelbeseitigung durch eine andere Firma durchführen zu lassen. Im August 2002 erklärte der Auftraggeber die Kündigung des Bauvertrags. Der Auftragnehmer machte daraufhin klageweise einen Restwerklohnanspruch geltend. Am 21.04.2016 erhob der Auftraggeber Widerklage und verlangte vom Auftragnehmer die Kosten der Mangelbeseitigung.
Nach Auffassung des OLG Dresden ist der Anspruch des Auftraggebers verjährt. Die vom Auftragnehmer geltend gemachte Verjährung greife ein. Mangelansprüche verjährten bei Bauwerken in fünf Jahren. Zwar beginne die Verjährung grundsätzlich erst mit der Abnahme der Leistung, dies sei aber nicht zwingend. Nach der Rechtsprechung des BGH fange die Verjährung auch dann zu laufen an, wenn der Auftraggeber die Entgegennahme des Werks als Erfüllung der Vertragsleistung ablehne, indem er die Abnahme endgültig verweigere. Es sei nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen, ob eine endgültige Abnahmeverweigerung in diesem Sinne vorliege. Habe der Auftraggeber dem Auftragnehmer erfolglos eine Frist mit Ablehnungsandrohung für die Beseitigung wesentlicher Mängel gesetzt, komme mit Ablauf dieser Frist eine Erfüllung der Vertragsleistung nicht mehr in Betracht. Mit dem erfolglosen Ablauf der Frist mit Ablehnungsandrohung habe der Auftraggeber daher die Abnahme endgültig verweigert. Der Auftraggeber sei wegen der Mängel der Bauleistung auf die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten beschränkt. Zugleich beginne spätestens mit der Geltendmachung eines dieser Rechte die Verjährung, ohne dass es auf eine Abnahme oder Abnahmereife ankomme.
4. Auch für Anlagenbauverträge kann die VOB/B verwendet werden
Ein Vertrag über die Errichtung einer Biogas-Aufbereitungsanlage stellt einen Werkvertrag dar. Die VOB/B kann nicht nur in einen Bauvertrag, sondern auch in einen Werklieferungs- oder einen Anlagenbauvertrag als Vertragsbestandteil einbezogen werden, so das OLG München in seinem Urteil vom 10.12.2019 (28 U 1575/17 – Bau). Die dagegen gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde wurde zurückgenommen (vgl. BGH, Beschluss vom 25.03.2019 – VII ZR 6/20).
In dem Rechtsstreit vor dem OLG München ging es unter anderem um die Fragen, welche Rechtsnatur ein Vertrag über die Errichtung einer komplexen Biogasanlage hat und ob die VOB/B in einen solchen Vertrag einbezogen werden kann.
Das OLG München hat den geschlossenen Anlagenbauvertrag als Werkvertrag eingestuft. Es hat zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einbeziehung der VOB/B nicht auf Bauverträge beschränkt sei, sondern die Parteien auf Grundlage der Vertragsfreiheit die VOB/B beispielsweise auch bei Werklieferungsverträgen nach § 650 BGB oder Verträgen über den Bau von Anlagen einbeziehen könnten.
5. Schadensersatz wegen Fehlern bei der Rechnungsprüfung nur bei einem Schaden
Der Architekt haftet jedenfalls dann nicht für Fehler bei der Rechnungsprüfung, wenn die von ihm freigegebenen Beträge unter dem Gesamtwert der Leistungen der bauausführenden Unternehmen liegen und ihm die über die Freigabe hinausgehenden Zahlungen des Bauherren nicht angelastet werden können. Das hat das OLG München mit Beschluss vom 13.02.2017 (27 U 3914/16 – Bau) entschieden. Die dagegen gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde hat der BGH mit Beschluss vom 04.09.2019 (VII ZR 80/17) zurückgewiesen.
Der Auftraggeber beauftragte einen Bauunternehmer mit der Errichtung einer Autobahnmeisterei. Aufgabe des ebenfalls von ihm beauftragten Architekten war unter anderem die Prüfung und Freigabe der Rechnungen des Bauunternehmers. Am 02.08.2010 prüfte der Architekt die 11. Abschlagsrechnung. Insgesamt wurden von ihm bis zum 03.08.2010 357.736,99 Euro freigegeben und vom Auftraggeber bezahlt. Danach leistete der Auftraggeber auf weitere Rechnungen des Bauunternehmers Zahlungen, ohne dass diesen Zahlungsfreigaben des Architekten zugrunde lagen. Insgesamt bezahlte er an den Bauunternehmer 425.381,36 Euro. Der Auftraggeber behauptete, dass zum Zeitpunkt der letzten Rechnungsprüfung am 02.08.2010 der tatsächliche Wert der erbrachten Leistungen um 143.000,00 Euro geringer gewesen sei als die vom Architekten freigegebenen Beträge. Nach Angaben des Auftraggebers lag der Gesamtwert der Leistungen des Bauunternehmers zum Zeitpunkt der Schlussrechnung des Bauunternehmers am 23.03.2011 bei 374.007,36 Euro. Im Berufungsverfahren begehrte der Auftraggeber Zahlung von 51.374,00 Euro.
Das OLG München verneinte einen entsprechenden Anspruch mit Hinweis darauf, dass es nicht darauf ankomme, welchen Wert die Leistung des Bauunternehmers zum Zeitpunkt der letzten Prüfung einer Abschlagsrechnung durch den Architekten gehabt habe, sondern auf den Wert der Unternehmerleistung zum Zeitpunkt der Schlussrechnung des Unternehmers am 23.03.2011. Der vom Gericht beauftragte Sachverständige berechnete den Gesamtwert der Leistungen des Bauunternehmers auf 381.850,85 Euro und selbst der Auftraggeber hatte diesen Wert mit 374.007,36 Euro angegeben. Da der Wert der freigegebenen Leistungen durch den Architekten nur 357.736,99 Euro betrage und geringer sei als der Gesamtwert der Leistungen des Bauunternehmers, fehle es an einem durch die fehlerhafte Rechnungsprüfung des Architekten zurechenbaren Schaden. Die über den vom Architekten geprüften und freigegebenen Betrag hinaus geleisteten Zahlungen habe der Auftraggeber selbst veranlasst. Hinsichtlich der nach der letzten Rechnungsprüfung des Architekten erfolgten Zahlungen des Auftraggebers fehle es an einem Zurechnungszusammenhang zur mangelhaften Rechnungsprüfung des Architekten. Der geltend gemachte Schaden, also die Differenz zwischen dem insgesamt gezahlten Betrag und dem Gesamtwert der Leistung des Bauunternehmers, sei daher nicht auf die fehlerhafte Rechnungsprüfung zurückzuführen.
6. Vergütung für zusätzliche Leistung auch ohne Anordnung des Auftraggebers
Der Auftragnehmerin steht für die Ausführung einer technisch zwingend notwendigen Zusatzleistung, die vom Auftraggeber nicht gemäß § 1 Abs. 4 VOB/B verlangt wird, ein Anspruch auf besondere Vergütung nach § 2 Abs. 6 VOB/B zu. In der Übersendung eines Nachtragsangebots liegt die für einen Anspruch auf zusätzliche Vergütung erforderliche Ankündigung, so das OLG Hamm in seinem Urteil vom 13.07.2017 (24 O 117/16). Die dagegen gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde hat der BGH mit Beschluss vom 10.07.2019 (VII ZR 209/17) zurückgewiesen.
Der Auftraggeber beauftragte die Auftragnehmerin mit der Installation von Brandmeldeanlagen am Neubau der Hochschule Ruhr-West an den Standorten C und N. Im Leistungsverzeichnis war die Programmierung der Ringleitungselemente, die zur Herbeiführung der ordnungsgemäßen Funktionalität der Brandmeldeanlage erforderlich ist, nicht enthalten. Die Auftragnehmerin erstellte über die Programmierung von Ringleitungselementen ein Nachtragsangebot, das der Auftraggeber nicht annahm. Sie erbrachte die entsprechende Leistung und rechnete sie mit 65.777,25 Euro brutto ab.
Das OLG Hamm hat den Vergütungsanspruch bestätigt. Die Programmierung von 2.211 Ringleitungselementen am Standort N gehöre zu der von der Auftragnehmerin vertraglich geschuldeten Leistung. Diese Leistung sei im Leistungsverzeichnis nicht enthalten. Sie ergebe sich jedoch daraus, dass die Auftragnehmerin ein nach den Vertragsumständen zweckentsprechendes, funktionstaugliches Werk zu erstellen habe, sogenannter funktionaler Leistungsbegriff. Danach stehe fest, dass die Auftragnehmerin auch am Standort N zur Herbeiführung der Funktionsfähigkeit der Brandmeldeanlage die erforderliche Programmierung von Ringleitungselementen vertraglich geschuldet habe. In dem von den Parteien geschlossenen Einheitspreisvertrag sei die Programmierung von Ringleitungselementen von der Vergütungsabrede nicht umfasst und stelle daher eine im Grundsatz zusätzlich zu vergütende Leistung dar. Dem Erfordernis einer vor Beginn mit der Ausführung der Leistung erfolgten Ankündigung des Anspruchs gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 1 Satz 2 VOB/B habe die Auftragnehmerin genügt, indem sie dem Auftraggeber ein entsprechendes Nachtragsangebot übersandt habe, mit welchem sie unter anderem die im Streit stehenden Leistungen angeboten habe.
7. In einer „Leistungskette“ gilt die Pauschalvereinbarung auch gegenüber dem Nachunternehmer
Hat ein Generalunternehmer von seinem Auftraggeber den vollen Werklohn erhalten und droht keine Rückforderung wegen angeblicher Überzahlung, kann er von seinem Nachunternehmer im Falle einer Mengenunterschreitung keine Reduzierung der vereinbarten Pauschalvergütung verlangen. Dies hat das OLG Celle mit Urteil vom 22.02.2018 (5 U 98/17) entschieden. Die dagegen gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde hat der BGH mit Beschluss vom 08.08.2019 (VII ZR 56/18) zurückgewiesen.
Ein Generalunternehmer wurde mit der Errichtung eines Supermarktes beauftragt. Die Ausführung der Erdbauarbeiten vergab er auf der Grundlage eines VOB/B-Einheitspreisvertrages an einen Nachunternehmer. Lediglich für die Leistungsverzeichnis-Position „Sand liefern und Einbauen“ mit einem Vordersatz von 8.720 m3 wurde ein Pauschalpreis vereinbart. Der Generalunternehmer erhielt vom Auftraggeber für diese Position die Vergütung in voller Höhe. Gegenüber dem Nachunternehmer verlangte er eine Reduzierung des Pauschalpreises mit dem Argument, der Nachunternehmer habe nur 5.544 m3 Sand eingebracht. Im Prozess stellte sich heraus, dass der Nachunternehmer 6.538 m3 Sand eingebracht hat.
Das OLG Celle hat den Vergütungsanspruch des Nachunternehmers bejaht. Die Vergütung bleibe nach § 2 Nr. 7 Abs. 1 VOB/B unverändert, wenn eine Pauschalsumme vereinbart sei. Nur wenn die ausgeführte von der vertraglich vereinbarten Leistung so erheblich abweiche, dass ein Festhalten an der Pauschalsumme nicht zumutbar sei, sei auf Verlangen ein Ausgleich unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu gewähren. Mit dieser Regelung sollten die in § 313 BGB verankerten Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlage herangezogen werden. Vorliegend hätten die Parteien die ursprünglich „angedachte“ Menge von 8.719,26 m3 zur Geschäftsgrundlage erhoben. Ein Recht auf Anpassung des Pauschalpreises habe der Generalunternehmer im vorliegenden Fall aber nicht. Der Generalunternehmer habe von seinem Auftraggeber die volle Vergütung erhalten und es bestünde nicht die Gefahr, auf Rückzahlung in Anspruch genommen zu werden. Habe in einer „Leistungskette“ von Werkunternehmern der Generalunternehmer seinerseits von „seinem Hauptauftraggeber“ den vollen Werklohn erhalten und drohe ihm keine Rückforderung wegen angeblicher Überzahlung, dann sei es dem Generalunternehmer verwehrt, von seinem Subunternehmer eine neue Vereinbarung des Preises gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 VOB/B zu verlangen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die Abweichung – wie vorliegend – lediglich 20 bis 22 % betrage. Es sei nicht ersichtlich, warum dem Generalunternehmer das Festhalten an der vereinbarten Vergütung unzumutbar sei.